|
Pressestimmen zu:
Mörike von A bis Z

Wochenspiegel (Ausgabe Südwest) vom 12.5.2000
| Mörike
aus einer anderen Perspektive
Stuttgart/Leinfelden (epd) Unter dem Titel
"Mörike von A bis Z" hat die Historikerin Karin de la Roi-Frey im DRW-Verlag
Weinbrenner; Leinfelden-Echterdingen, eine unkonventionelle Biografie Eduard Mörikes
(1804-1875) veröffentlicht. Anhand von 35 Stichwörtern stellt die Autorin den
Dichterpfarrer aus einer ungewohnten und teilweise auch unbekannten Perspektive vor. Viele
Facetten aus dem Leben des großen Lyrikers werden beleuchtet - etwa seine Freundschaften
und Liebschaften, sein Verhältnis zu Glauben und Beruf.
Aber auch über Mörikes Arbeitsstil, seine Liebe zu Rosen oder seine Einstellung
zur Kochkunst erfährt der Leser manches. Schnitz und Zwetschgen und Ofenschlupfer
etwa waren nicht nach Mörikes Geschmack, dagegen schätzte er Süßes wie
Makronen und geröstete Mandeln.
In ihrer informativen und amüsanten Mörike-Recherche hinterfragt Karin
de la Roi-Frey das Klischee vom "Pfarrhauseremiten", Biedermeierdichter
und Idylliker. In dem 140-seitigen Buch mit zahlreichen Abbildungen bekommt
der Mensch Mörike Konturen. "Der museale Firnis des Mörike-Bildes
erhält Kratzer", so die in der Nähe von Stuttgart lebende Autorin
in der Einleitung des am 3. Mai vorgestellten Buches. Aus der Feder der
promovierten Geschichtswissenschaftlerin stammen auch die beiden Bände
"Frauenleben im Biedermeier" und "Uhland von A bis Z"
(beide DRW-Verlag).
|
© Wochenspiegel

Ludwigsburger Kreiszeitung vom 3. Juni 2000
|
Ein
unglücklicher Pfarrer und romantischer Dichter
von A bis Z
Eduard Mörike: "Idyllendichter" oder
"schwäbischer Goethe" - Buch mit alphabetischem Porträt und Gedichten
 Eduard Mörike, Sohn der Stadt Ludwigsburg, unglücklicher Pfarrer in
Cleversulzbach und Dichter der Romantik. Am 4. Juni vor 125 Jahren starb der lange
kränkelnde Poet in Stuttgart. Jetzt hat sich die Autorin Karin de la Roi-Frey mit der
facettenreichen Person des schwäbischen Literaten von A bis Z auseinandergesetzt. Eduard Mörike, Sohn der Stadt Ludwigsburg, unglücklicher Pfarrer in
Cleversulzbach und Dichter der Romantik. Am 4. Juni vor 125 Jahren starb der lange
kränkelnde Poet in Stuttgart. Jetzt hat sich die Autorin Karin de la Roi-Frey mit der
facettenreichen Person des schwäbischen Literaten von A bis Z auseinandergesetzt.
Eduard Friedrich Mörike wurde am 8. September 1804 als siebtes von 13 Kindern
des Ludwigsburger Stadt- und Amtsarztes Karl Friedrich Mörike geboren.
Der Vater starb früh, Eduard wuchs bei einem Onkel auf und wurde für die
geistliche Laufbahn bestimmt. Er besuchte das Seminar in Urach und das
berühmte "Stift" in Tübingen.
Als Gemeindepfarrer kam er 1834 nach Cleversulzbach. Seine Amtspflichten
empfand er in dieser fruchtbarsten Zeit seines dichterischen Schaffens
als Last. Mit 39 Jahren ließ er sich pensionieren.
1851 trat er in Stuttgart die Nachfolge des verstorbenen Gustav Schwab
als Dozent für Literaturgeschichte am Katharinenstift an. Auch Familienglück
stellte sich ein. In diesem Jahr heiratete der 47-jährige Margarethe Speeth.
Seine Frau gebar ihm zwei Mädchen. Die Universität Tübingen verlieh dem
Poeten 1852 den Ehrendoktor "für seine vorzüglichen Verdienste um
die schwäbische Dichtkunst", 1856 folgte der Titel eines Professors.
Als Dichter anerkannt, war Mörike seit langem zu dem um Justinus Kerner
gescharten Schwäbischen Dichterkreis eingeladen, dem auch Uhland und Lenau
angehörten.
Im Spätherbst 1866 legte der Dichter sein Lehramt nieder, Krankheit und
Vereinsamung nach zerrütteter Ehe kennzeichneten sein Privatleben im Alter.
Mörike starb am Vormittag des 4. Juni 1875. Seine Heimat hat er nie verlassen.
Als Lyriker und Erzähler zählt der Sohn des "Horaz und einer Schwäbin",
wie ihn Gottfried Keller nannte, zu den bedeutendsten Dichtern des 19.
Jahrhunderts.
Wer kennt es nicht, das wohl berühmteste Gedicht Eduard Mörikes: "Frühling
läßt sein blaues Hand wieder flattern durch die Lüfte ...", ein Evergreen
der romantischen Dichtung. Ein Meisterwerk der deutschen Literatur.
Übrigens hieß das erste Gedicht, das Mörike unter seinem vollen Namen veröffentlichte,
"Württembergs Trauer seit dem 9ten Januar l819". Er hatte es
anlässlich des plötzlichen Todes der beliebten Königin Katharina geschrieben.
Doch dies war nur der Anfang eines umfangreichen und fruchtbaren literarischen
Schaffens des Pfarrers wider Willen. Der Klangreichtum von Mörikes rhythmisch
ausgefeilten und bildhaften Gedichten sowie die vielgepriesene Tiefe von
Ausdruck und Gedanken in seiner Lyrik und Prosa machen ihn zu einer weit
über seine schwäbische Heimat hinaus bedeutenden dichterischen Persönlichkeit
In dem jetzt erschienen Buch von Karin de la Roi-Frey wird ein aufschlussreiches
Portrait des Dichters von A wie Aussteiger, über K wie Kochkunst bis Z
wie Zwischenstation beschrieben. Zu jedem Buchstaben des Alphabets hat
die findige Autorin Geschichten, Anekdoten und Wissenswertes über Eduard
Mörike zusammengestellt.
Ihre liebevolle und hintergründige Recherche förderte dabei auch weniger
bekannte Ergebnisse zutage und gewährte zusätzliche Einblicke in das Leben
und Wirken des sensiblen und eigenwilligen Lyrikers aus Ludwigsburg. Die
Autorin beleuchtet die verschiedensten Aspekte und lässt den Menschen und
Dichter in zahlreichen Zitaten und Gedichten auch selbst zu Wort kommen.
Hinter dem Klischee des "kleinen verträumten Pfarrhauspoeten"
tritt dem Leser der Mensch Mörike mit all seinen Eigenheiten, Freuden und
Sorgen entgegen. Diese Begegnung sorgt für ein unterhaltsames und aufschlussreiches
Leseerlebnis.
...
(mol)
|
© Ludwigsburger Kreiszeitung

Bietigheimer Zeitung vom 27.6.2000
| LITERATUR
/ Ludwigsburger Dichter von A bis Z
Über Mörikes Lust und Laster
Ein neues
Buch gewährt unbekannte Einblicke in das Leben des eigenwilligen Lyrikers

Eine der bekanntesten Darstellungen des
"Schwabendichters" Eduard Mörike, ein Aquarell von Louise Walther aus dem Jahr
1874. |
LUDWIGSBURG (itz). Der 1804 in Ludwigsburg geborene Dichter Eduard Mörike
schuf zwar rhythmisch ausgefeilte Gedichte, blieb sein Leben lang jedoch sensibel und
eigenwillig. Die Autorin Karin de la Roi-Frey hat in einem neuen Buch nun die unbekannten
Seiten des Menschen Mörike aufgeschlagen.
Es ist ein eigenartig melancholisches Bild, das die Autorin Roi-Frey in
ihrem Buch "Mörike von A bis Z" über den Schwabendichter aus
Ludwigsburg zeichnet. Er habe die überschaubare Enge ohne gefährliche Überraschungen
geliebt, um sich so seine mühsam hergestellte Gemütsruhe zu bewahren, meint sie.
Der Dichter Theodor Storm schrieb ganz anders über den Lyriker: "Mörike
ist in einer Beziehung selbst von den größten Poeten, Goethe nicht ausgenommen,
ganz unerreicht. Keiner hat so wie er neben der Tiefe des Gedankens auch
die Tiefe des Ausdrucks und so einen wunderbar notwendigen Zusammenhang
zwischen beiden beschrieben". Zwischen dieser "selbstverordneten
Gemütsruhe" und den Tiefen des lyrischen Ausdrucks spielt sich auch
das Buch von Karin de la Roi-Frey ab. Ein aufschlussreiches Porträt, voller
Anekdoten und Wissenswertes.
Nicht fehlen dürfen da die Frauengeschichten des Dichters, die in dem Buch
allerdings einen ganz zarten Ton bekommen. Während man über Goethes Geschichten
ganze Bücher füllte und über Schillers "menage a trois" mit den
Schwestern Lengefeld in Jena klatschte, gab es bei Mörike ein "üppig
erblühtes Weib" namens Maria Meyer, die er 1823 in Ludwigsburg kennenlernte.
Die Tochter einer stadtbekannten Dirne wurde ohnmächtig auf der Straße
liegend aufgefunden und übte mit ihrer faszinierenden Schönheit, einer
erstaunlichen Belesenheit und dunkler Zukunft einen unwiderstehlichen Reiz
auf den Dichter aus.
Eine unbekannte Note: Das spurlose Verschwinden von Maria Meyer aus der
Barockstadt stürzte Mörike in eine tiefe Daseins- und Sinneskrise. Was
sich tatsächlich zwischen den beiden abgespielt hat, darüber rätselt die
Literaturwissenschaft, so die Autorin Roi-Frey. Mörike habe alle Briefe
verbrannt und alles vermieden, Licht in die lasterhafte Affäre zu bringen.
Eine ganz andere Seite: Konnte Eduard Mörike kochen? Und was aß er gerne?
Die Autorin versucht, auch auf diese einfachen Fragen eine Antwort zu geben
- und kommt zu überraschenden Antworten. Der Dichter tunkte seine über
dem Kerzenlicht erwärmte Milch auf und aß Wecken dazu.
Öfter soll er gar ganz aufs Essen verzichtet haben, wenn Mutter, Schwester
oder Ehefrau nicht zur Verfügung standen. Sobald sich der Ludwigsburger
jedoch an gedeckte Tische setzte, erwachten in ihm lustvolle kulinarische
Genüsse, schreibt Karin de la Roi-Frey in ihrem Buch. Vor allem Konstanze,
die Frau seines Freundes Wilhelm Hartlaub, gehörte zu jenen, die ihn mit
ihrer Meisterschaft in den Künsten der Küche beglücken durfte
Lebenslauf fehlt
Selbstverständlich werden in dem Buch auch
andere Stichworte mit viel Geschichten untermauert. Mörike als "Aussteiger",
seine Entfremdung vom Christentum, ein Blick auf die Eltern und die "Weinsberger
Herrenrunde". Einziges Manko des Buches: Was fehlt, ist ein tabellarischer Lebenslauf
Mörikes, an dem sich der Leser anhand des alphabetischen Aufbaus des Buches orientieren
könnte.
"Mörike von A bis Z" von Karin de la
Roi-Frey, erschienen im DRW-Verlag, 144 Seiten mit 20 Abbildungen, fester Einband, 24
Mark.
|
© Bietigheimer Zeitung

Heilbronner Stimme vom 3.7.2000
 Mörikefest in Cleversulzbach Mörikefest in Cleversulzbach
Der Hahn ist wieder heimgekehrt
Von Barbara Barth
160 Jahre war der alte Cleversulzbacher Turmhahn
nicht zu Hause, nun ist er heimgekehrt. Er, den der Dichter Eduard Mörike unsterblich
gemacht hat, ist wenigstens vorübergehend dorthin zurückgekommen, wo er sich 113 Jahre
lang an der Spitze des Kirchturms gedreht hat.
Bis Ende des Jahres ersetzt das Original die Kopie im Mörike-Museum des
Neuenstädter Teilorts. Einen Unterschied sehen nur die Kenner: Das Original
ist schwärzer.
Der Turmhahn zu Cleversulzbach hat ein bewegtes Leben hinter sich. Als
1840 ein Blitzschlag den Kirchturm zerstörte, musste er seinen hohen Standort
verlassen. Da lag er dann beim Schmied Salm zwischen all dem alten Eisen.
Eduard Mörike, von 1826 bis 1843 Pfarrer in Cleversulzbach, nahm sich des
Hahns an und schrieb zumindest die ersten Zeilen des Idylls vom Turmhahn
noch in seiner Cleversulzbacher Zeit. Nach Mörikes Tod ersteigerte das
Schiller- und Goethe-Archiv in Weimar den Nachlass, auch den Hahn. Das
fuchste die Marbacher. Das dortige Literaturarchiv tauschte schließlich
22 Blätter aus anderen Nachlässen gegen den Hahn, der damit 1922 nach Württemberg
zurückkehrte. Jetzt wird das Schiller-Nationalmuseum in Marbach renoviert.
Ehe der eiserne Gockel in den Katakomben verschwunden wäre, holten ihn
sich die Cleversulzbacher auf Zeit heim.
Das Mörikefest am Samstag aus Anlass des 125. Todestages des Dichters hatte damit seine Attraktion. Doch es gab noch andere: Michael Koszt, Budapester Künstler und seit 32 Jahren in Neuenstadt ansässig, stellte einen Zyklus aus acht Tuschezeichnungen vom Mörikepfad vor: Blicke auf Cleversulzbach, die der Dichterpfarrer beschrieben hat.
Die Autorin Karin de la Roi-Frey präsentierte
ihr Buch "Mörike von A bis Z" (DRW-Verlag). Die Nordfriesin,
die ihr Herz für schwäbische Dichter entdeckt hat, sammelte zu jedem Buchstaben des
Alphabets zumeist Bekanntes über Mörike. Da am Samstagabend schwarze Gewitterwolken die
Festgäste vom Museumshof in die St.-Jost-Kirche vertrieben, las sie dort, wo Mörike
seinen ungeliebten Pfarrerberuf ausübte. "Ein ganz besonderer Moment", so die
Autorin ehrfürchtig.
Helmut Braun, der intime Neuenstädter Mörike-Kenner, begab sich auf eine
intensivere Spurensuche, stellte den Menschen vor, der "nie zu Hause
war" und dessen Schaffenskraft mit 51 Jahren erlosch.
Der neugegründete, gemeinnützige Verein "Freunde des Mörike-Museums", der das Fest mit der Stadt Neuenstadt ausrichtete, hat große Pläne:
Das alte Schulhaus neben dem Museum wird frei und soll ebenfalls für Museumszwecke
saniert werden. Zum 200. Geburtstag des Dichters im Jahre 2004 wäre ein
geeigneter Zeitpunkt für die Einweihung. Ebenso wie für die endgültige
Heimkehr des Turmhahns - als Leihgabe. "Das wäre ein Traum",
schwärmt der Vereinsvorsitzende.
|
© Heilbronner Stimme
|
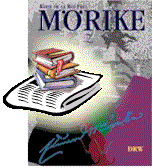
![]()
![]()
![]()
![]()
 Mörikefest in Cleversulzbach
Mörikefest in Cleversulzbach
 Eduard Mörike, Sohn der Stadt Ludwigsburg, unglücklicher Pfarrer in
Cleversulzbach und Dichter der Romantik. Am 4. Juni vor 125 Jahren starb der lange
kränkelnde Poet in Stuttgart. Jetzt hat sich die Autorin Karin de la Roi-Frey mit der
facettenreichen Person des schwäbischen Literaten von A bis Z auseinandergesetzt.
Eduard Mörike, Sohn der Stadt Ludwigsburg, unglücklicher Pfarrer in
Cleversulzbach und Dichter der Romantik. Am 4. Juni vor 125 Jahren starb der lange
kränkelnde Poet in Stuttgart. Jetzt hat sich die Autorin Karin de la Roi-Frey mit der
facettenreichen Person des schwäbischen Literaten von A bis Z auseinandergesetzt.